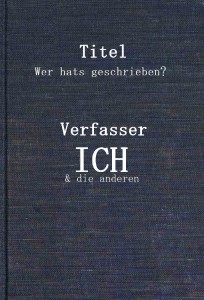Der Impact Factor hat einige handfeste Nachteile und stiehlt dennoch allen anderen Journalrankings die Show. Zahlreiche Ratings und Indexe versuchen sich als Alternative zu diesem vielbeachteten Überranking zu vermarkten, indem sie Lösungen zu konkreten Kritikpunkten anbieten. Ganz anders der Immediacy Index, der wie der Impact Factor aus dem Hause Reuters stammt und ebenfalls auf der Zitatedatenbank von Web of Science basiert. Seine Zielsetzung besteht nicht darin, Unzulänglichkeiten auszubessern (man ist versucht zu rufen: „im Gegenteil!“), sondern es wird hier angeblich etwas anderes gemessen: Nicht mehr, wie stark Artikel beachtet werden, sondern wie angesagt die Themen sind, denen sich ein Journal widmet. Wie schnell andere Autoren auf einen Artikel reagieren, gilt dabei als Indikator für die Brisanz.
Der Impact Factor hat einige handfeste Nachteile und stiehlt dennoch allen anderen Journalrankings die Show. Zahlreiche Ratings und Indexe versuchen sich als Alternative zu diesem vielbeachteten Überranking zu vermarkten, indem sie Lösungen zu konkreten Kritikpunkten anbieten. Ganz anders der Immediacy Index, der wie der Impact Factor aus dem Hause Reuters stammt und ebenfalls auf der Zitatedatenbank von Web of Science basiert. Seine Zielsetzung besteht nicht darin, Unzulänglichkeiten auszubessern (man ist versucht zu rufen: „im Gegenteil!“), sondern es wird hier angeblich etwas anderes gemessen: Nicht mehr, wie stark Artikel beachtet werden, sondern wie angesagt die Themen sind, denen sich ein Journal widmet. Wie schnell andere Autoren auf einen Artikel reagieren, gilt dabei als Indikator für die Brisanz.
Kaum alte Probleme behoben, aber neue geschaffen
Der Impact Factor gibt jeder Ausgabe eines Journals mindestens zwei Jahre Zeit, bevor nachgezählt wird, wie oft die Artikel im Schnitt zitiert wurden. Beim Immediacy Index hingegen werden nur die Zitate beachtet, die noch im selben Kalenderjahr veröffentlicht werden wie der Artikel, auf den sie sich beziehen. Somit hat jeder Aufsatz zwischen einem und 364 Tagen Zeit, zitiert zu werden – eine kurze Zeitspanne in der eher schwerfälligen Welt von Projektanträgen, Budgetentscheidungen, eigentlicher Forschung, Schreibphase, Peer Review und möglicherweise Ablehnung und nochmaligem Peer Review. Dies verursacht zusätzliche Probleme, die zu den Kritikpunkten am Impact Factor hinzukommen: Journals, die weniger oft oder später im Kalenderjahr erscheinen, haben wenig Gelegenheit, noch vor Silvester zitiert zu werden. Gewisse Artikeltypen lösen zudem schneller Zitate aus, etwa Reviewartikel, die systematisch erfassen, was bereits bekannt war und daher weniger intensiv „verdaut“ werden müssen.
Wie wichtig ist der Coolnessfaktor eigentlich?
Zu diesen schwerwiegenden methodischen Problemen gesellen sich noch unangenehme Grundsatzfragen, die bereits aus der Impact Factor Diskussion bekannt sind, die sich bei dem „schneller ist besser“ Ansatz des Immediacy Indexes aber noch stärker aufdrängen: Ist ein Artikel, der viele Leute anspricht, besser als einer, der einen Durchbruch in einem enger gesteckten Feld bedeutet? Sind hochaktuelle, aber möglicherweise kurzlebige Themen wichtiger als Fragestellungen, die sich langsam aber stetig entfalten? Vielsagend ist diesbezüglich, dass Journals eine lange cited half-life Wertung anstreben, mit anderen Worten: Artikel veröffentlichen möchten, die auch nach Jahren noch oft zitiert werden.
Wenig dazugelernt
Die Korrelation zwischen Immediacy Index und Impact Factor ist hoch, die beiden Indices sind sich ähnlicher als jede andere Paarung von geläufigen Journalrankings. Nur in sehr jungen Forschungsdisziplinen laufen die beiden Kennzahlen etwas auseinander. Der Immediacy Index bietet folglich wenig zusätzliche Information. Damit muss sich Thomson Reuters den Vorwurf gefallen lassen, eher daran interessiert zu sein, neuen Journals rasch Zugang zu einem Ranking gewähren zu können, als zu ernsthaften Evaluationen beitragen zu wollen.
Immerhin: Der Immediacy Index kam in verschiedenen Studien zum Einsatz, die belegen konnten, dass Journals, die online erscheinen, rascher zitiert werden als reine Printausgaben – ein nützliches Argument in der Debatte um neue Publikationsformen, wenn auch eben keine Sensationsentdeckung. Vielleicht hat sich darin die Nützlichkeit des Immediacy Indexes auch bereits erschöpft. Wie beim coolen Bruder gilt: Rockstartstatus erlangen nur wenige. Dem Rest stehen echte, fassbare Vorteile besser als coole Posen.