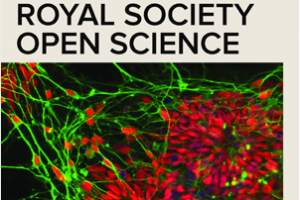 Die Royal Society steht kurz vor dem 350. Jubiläum ihrer ersten Publikation und darf sich somit als ältester noch existierender akademischer Verlag bezeichnen. Fast zeitgleich mit dem Jubiläum wagt das Haus den Sprung in die Zukunft: Die Royal Society lanciert einen weiteren Open Access Titel, welcher Forschern naturwissenschaftlicher Disziplinen offen stehen wird. In der entsprechenden Pressemitteilung spricht der Verlag verschiedene Schwächen des klassischen Publikationsmodells an und erklärt, wie diesen mit dem neuen Titel „Royal Society Open Science“ entgegengewirkt wird.
Die Royal Society steht kurz vor dem 350. Jubiläum ihrer ersten Publikation und darf sich somit als ältester noch existierender akademischer Verlag bezeichnen. Fast zeitgleich mit dem Jubiläum wagt das Haus den Sprung in die Zukunft: Die Royal Society lanciert einen weiteren Open Access Titel, welcher Forschern naturwissenschaftlicher Disziplinen offen stehen wird. In der entsprechenden Pressemitteilung spricht der Verlag verschiedene Schwächen des klassischen Publikationsmodells an und erklärt, wie diesen mit dem neuen Titel „Royal Society Open Science“ entgegengewirkt wird.
- Der vordringlichste Punkt betrifft die teils fragwürdigen Kriterien, die ein Artikel erfüllen muss, um in einem Topjournal veröffentlicht zu werden (auch Publikationen der Royal Society selbst sind gemeint). Hierfür muss die Forschung ein aktuelles und viel diskutiertes Thema behandeln und möglichst spektakuläre Resultate liefern. Es gibt aber auch wichtige Arbeiten abseits des Scheinwerferlichts. Oftmals offenbart sich die wahre Brisanz erst nach einiger Zeit, die Arbeit ist nur in einer kleinen Nische relevant, oder die Redaktoren verkennen schlicht die Wichtigkeit des Themas. Auch negative Resultate, bei denen die Forschungsthese nicht bestätigt wird, beinhalten mitunter interessante Erkenntnisse und wertvolle Daten. Schließlich gibt es Themen, die sich nicht auf die übliche Seitenzahl reduzieren lassen. Solche Artikel lassen sich im klassischen Publikationsbetrieb nur schwer vermarkten. Sie unveröffentlicht zu lassen, beraubt die akademische Gemeinschaft aber der enthaltenen Informationen. Die neu geschaffene Plattform kreiert deshalb einen offeneren, weniger exklusiven und zugänglicheren Raum.
- Auch wenn der Verlag diesen Punkt nicht explizit erwähnt: Experimente im Bereich Open Access sind willkommen. Die Leserschaft kostenlos mit Inhalten zu bedienen, ist ein interessantes und wichtiges Ziel. Ein universales, optimales Geschäftsmodell konnte sich hierfür noch nicht herauskristallisieren und es existiert womöglich auch nicht. Erfahrungen damit zu sammeln, wie sich das neue Journal auf die übrige Produktpalette des Verlags auswirkt, kann möglicherweise einen Beitrag zur Klärung leisten.
Open Access schließt im Fall Royal Society Open Science auch in Arbeiten verwendete Daten ein. Diese stehen für weiterführende Forschung oder für die Replikation von Resultaten zur Verfügung.
- Effizienz ist in mehr als einer Hinsicht Trumpf: Nicht nur, dass das Onlineformat die Druckkosten einspart, sondern es kommt auch ein sogenanntes Cascading Peer Review zum Einsatz. Dies betrifft Artikel, die ursprünglich für andere Journals der Royal Society Familie eingereicht wurden, die den Qualitätsansprüchen genügen, die jedoch nicht exakt ins jeweilige Programm passen. Beispielsweise aus oben genannten Gründen. Im Normalfall werden solche Artikel nach einem mehrmonatigen Prozess abgelehnt, worauf die Autoren versuchen werden, sie bei einem besser geeigneten Titel zu platzieren. Dort wird das Peer Review von anderen Experten durchgeführt und beginnt folglich bei Null. Neu können betreffende Artikel an Royal Society Open Science weitergegeben werden, die Doppelspurigkeit beim Review entfällt.
- Die Plattform regt zu einer neuen Form des Reviews an, bei welcher Kollegen und Leser Kommentare zu publizierten Artikeln abgeben können, welche gegebenenfalls zu einer Revision führen. In Anbetracht der Kritik, die das Peer Review System momentan erfährt, ist dies eine interessante Entwicklung. Dass ein solch bedeutendes Verlagshaus die Idee als Ergänzung zum klassischen Peer Review aufgreift, wird ebenfalls zu neuen Einsichten über diese Variation des Publizierens führen.
Auch bei der American Association for the Advancement of Science, dem Herausgeber des Journals Science, steht die Lancierung eines Open Access Titels bevor. Das neue Journal wird Science Advances heißen. Ob und in welcher Form Open Access den akademischen Forschungsbetrieb als Ganzes beeinflussen wird, bleibt abzuwartem. In der Zwischenzeit darf sich die akademische Gemeinde auf einfachere, zugängliche und vor allem auf mehr Inhalte freuen.


